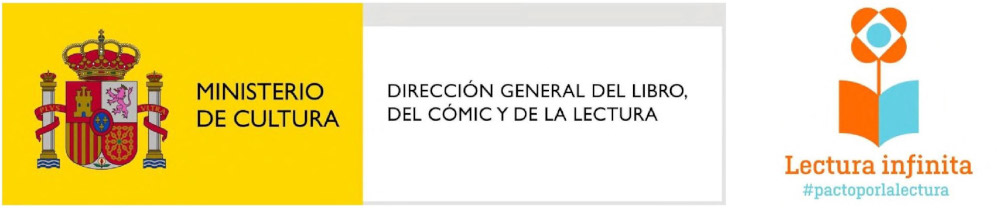Tristan und Isold, 2 Bde
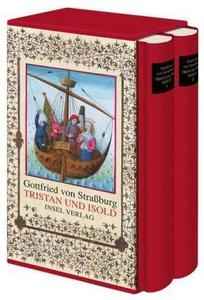
Resumen del libro
Mit "Tristran et Ysolt / Tristan und Isold" tritt das Thema einer gro en illegitimen Liebe in die Weltliteratur ein. Geheimnisvoll sind die Quellen des Stoffes. Eine unabsehbare Zahl von Deutungen und Adaptionen in Literatur, Musik und Film belegt seine Wirkung über Jahrhunderte bis in die unmittelbare Gegenwart. Der Liebestrank, die verhängnisvolle schwarze Flagge und der tragische Tod der Protagonisten sind Bestandteile auch der populären kulturellen Erinnerung.
Die Geschenkausgabe enthält den kritisch geprüften mittelhochdeutschen Text und parallel dazu eine Übersetzung in ein lebendiges und packendes Gegenwartsdeutsch. Der reichhaltige Kommentar bietet die nötigen sachlichen und sprachlichen Erläuterungen. Er folgt den Wegen der Forschung und gibt Anregungen für mögliche neue Deutungen des Werkes.
Rezension
--------------------------------------------------------------------------------
"Eine ganz besondere Übersetzungs- und Editionsleistung ist die ... Ausgabe von Gottfried von Strassburgs Versroman Tristan und Isold . Wer wissen will, weswegen Gottfrieds Tristan und Isold einer der ganz gro en Liebesromane der Weltliteratur und wahrscheinlich der erste durchkomponiert psychologische Roman ist, der lese die neu übersetzte und kommentierte Ausgabe von Walter Haug." (ORF Ö1 Hörfunk)
Biografía del autor
Gottfried von Stra burg, Verfasser der um 1210 entstandenen bedeutendsten mhd. Tristandichtung. Der Name des Autors ist nur durch spätere mhd. Dichter überliefert. Lebensdaten sind keine bekannt. Ob der Beiname von Stra burg Herkunfts- oder Wirkungsort (bzw. beides) bezeichnet, ist offen. In den Handschriften wird G. in der Regel als meister (Magister) bezeichnet, Hinweis auf seine lat. Bildung. Da er nirgends als her erscheint, geht man von einer nichtadeligen Herkunft aus. Man nimmt eine Beziehung zum Stra burger Stadtpatriziat an, in dessen Kreis man auch den im Akrostichon des Prologs verschlüsselt genannten Gönner Dieterich vermutet. G. stützte sich auf eine frz. Vorlage, den 'Tristan' des Thômas von Britanje (Thomas d'Angleterre), eine um 1170 entstandene höfische Version des Stoffes, die nur bruchstückhaft überliefert ist. Das Eigene der dt. Dichtung sind zum einen die Kommentare und Reflexionen, die das vielschichtige, anspielungsreiche, ambivalente und von einer ironischen Erzählhaltung geprägte Werk durchdringen, zum andern die artistische Sprachkunst G.s, die Eleganz mit Präzision und Klarheit verbindet.